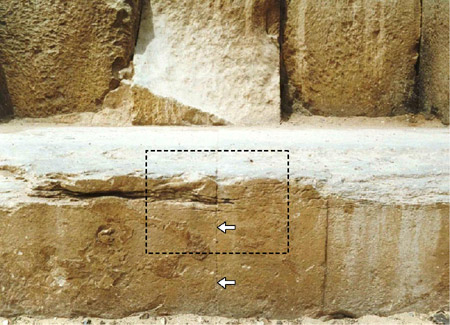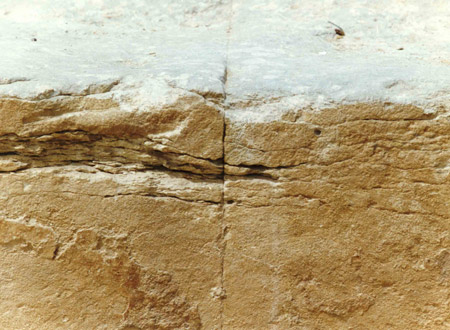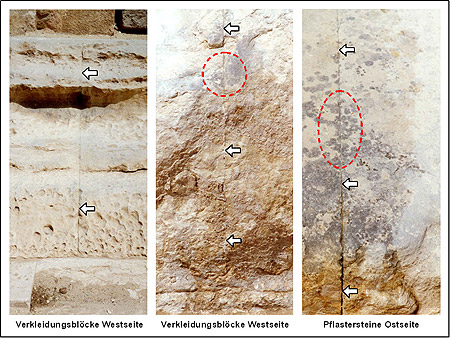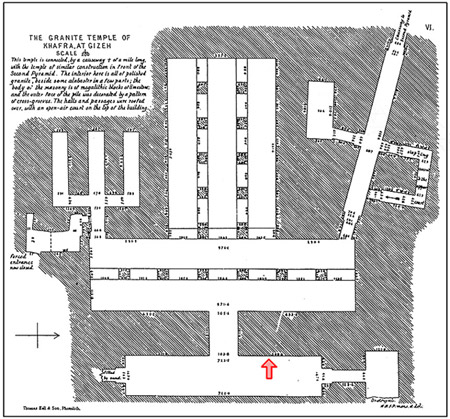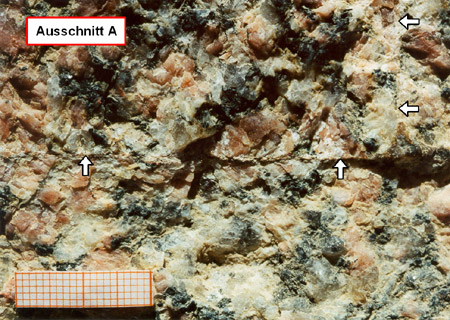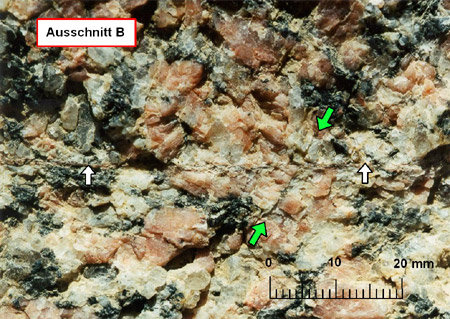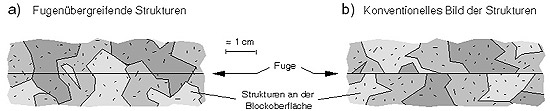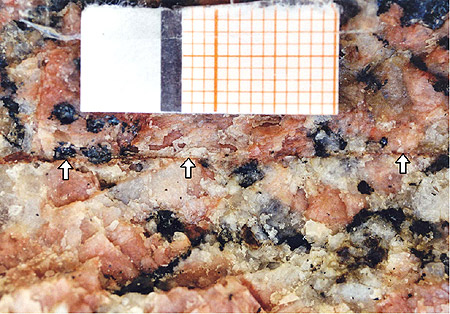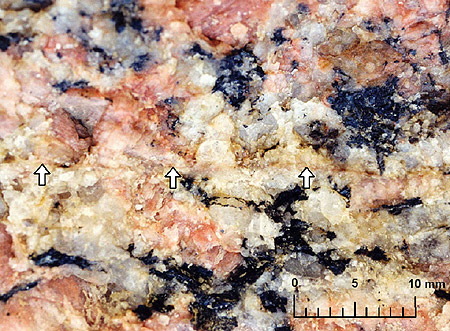Ein bautechnisches Phänomen
1. AllgemeinesAuf dem Pyramidengelände in Giza trat ein
bautechnisches Phänomen zutage, das mit unserem bisherigen Wissen nicht mehr
vereinbar wäre, falls es sich bewahrheiten sollte. Wir könnten es mit der
heute zur Verfügung stehenden, modernen Technik nicht erklären. Dies sei
vorweg gesagt. Wegen des besseren Verständnisses werden wir schrittweise
herangehen. Hinweis: Die Fotos hier lassen sich durch Anklicken vergrößern.
 Abbildung 4.1:
Abbildung 4.1: Die Nordseite der
Cheops-Pyramide (links im Hintergrund) auf den so genannten
Pflastersteinen (Vordergrund). Rechts davon ist der stabile
Felsuntergrund zu sehen.
Abbildung 4.1 zeigt die Nordkante der Cheops-Pyramide. Im Vordergrund sieht
man die so genannten Pflastersteine, auf denen die Pyramide steht. Im
Hintergrund sind noch einige der schrägen Verkleidungsblöcke zu erkennen,
die ursprünglich die Original-Oberfläche der Pyramide bildeten. Nahezu die
gesamten Außenverkleidungen der Pyramiden von Giza ist im Mittelalter
entfernt und in Kairo (vermutlich) zum Bau von Häusern, Brücken und Moscheen verwendet
worden. Sowohl die Verkleidungsblöcke als auch die Pflastersteine sind aus
hochwertigem weißem Kalkstein. Vor Ort fällt als erstes auf, dass z. B. die
Pflastersteine nicht rechtwinklig sondern schiefwinklig geschnitten sind. In
Abb. 4.2 ist der Fugenverlauf zwischen vier Pflastersteinen zu sehen, welche
übrigens ein Gewicht von einer oder mehreren Tonnen haben. Es gibt kaum
rechte Winkel und zudem haben die Blöcke oft mehr als vier Seitenflächen.
Sie sind quasi ineinander verzahnt, was einen erheblichen Mehraufwand beim
Bau bedeutet haben muss. Dieser technische Aufwand wäre aus baustatischen
Gründen kaum nötig gewesen, da die Pflastersteine ursprünglich eine große
Fläche bildeten und damit seitlich nicht wegrutschen konnten. Abbildung 4.3
zeigt die Nahaufnahme einer solchen Fuge. An der Millimeterskala des
Maßbandes ist zu erkennen, dass die Fugenbreite deutlich unter einem
Millimeter liegt.
 Abbildung 4.2:
Abbildung 4.2: Oberfläche einiger Pflastersteine
in ursprünglicher Position. Die Blöcke sind präzise
geschnitten, die Fugen bilden jedoch kaum rechte Winkel
miteinander.
 Abbildung 4.3:
Abbildung 4.3: Wie schon vorher bekannt war, sind
die Fugen so fein, dass man keine Stecknadel zwischen die
Blöcke bekommt. Das Maßband dient zur Abschätzung der
Fugenbreite.
2. Fugenübergreifende Strukturen in Kalkstein
In Abbildung 4.4
ist eine senkrechte Seitenfläche der Pflastersteine zu erkennen, da im
Vordergrund einige Blöcke entfernt wurden. Abb. 4.5 zeigt einen Ausschnitt
aus Abb. 4.4, der aus kürzerer Distanz photographiert wurde. Hier ist ein merkwürdiges
Phänomen zu beobachten. Deutlich sind einige Schichtungen im Gestein
erkennbar. Diese entstanden dadurch, dass über viele Jahre schwächere
Schichten durch Wind und Wetter (Sandsturm) heraus gewaschen wurden. An sich
ist das nichts Besonderes; das Merkwürdige ist nur, dass sich diese
Schichten über die senkrecht verlaufende Fuge fortzusetzen scheinen. Solche
Strukturen werden im Folgenden als „fugenübergreifend“ bezeichnet. Dabei
gibt es keinen Versatz, d. h. keine senkrechte Verschiebung an der Fuge.
Durch die Fuge ist klar, dass es sich um zwei verschiedene Blöcke handelt.
Es sieht so aus, als gehörten diese Blöcke im gewachsenen Fels ursprünglich
zusammen.
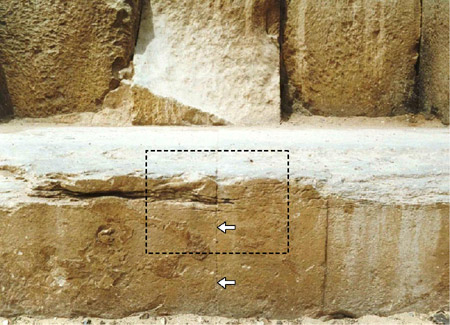
Abbildung 4.4: Frontseite von Pflastersteinen an der
Ostseite der Cheops-Pyramide mit natürlichen Schichtungen.
Der Ausschnitt im gestrichelten Rahmen wird im nächsten Bild
detaillierter gezeigt.
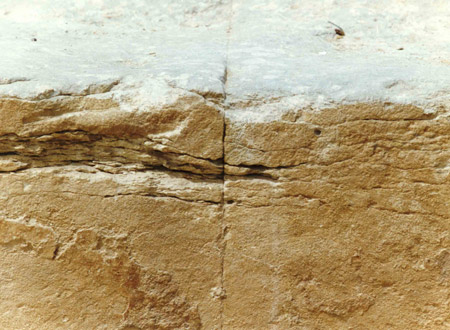
Abbildung 4.5: Wie in Abb. 4.4 aus geringerem Abstand.
Die Schichten sind „fugenübergreifend“ ohne Versatz.
Dieses Phänomen ist auch an den Oberflächen der Pflastersteine und der
Verkleidungsblöcke zu beobachten. In Abb. 4.6 ist links die stark
verwitterte Oberfläche von Verkleidungsblöcken der untersten Lage auf der
Westseite gezeigt. Der Verlauf der senkrechten Fuge ist durch weiße Pfeile
markiert, wie auch in den rechten Teilbildern und nachfolgenden Fotos.
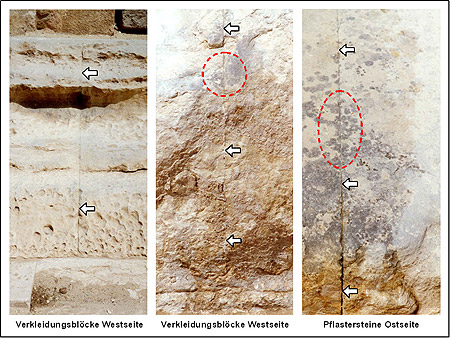
Abbildung 4.6: Links und Mitte: Mehr oder weniger stark verwitterte
Verkleidungsblöcke an der Westseite der Cheops-Pyramide, rechts: Oberfläche
von Pflastersteinen an der Ostseite.
Die gleichen Oberflächen an
einer anderen Stelle der Westseite (mittleres Teilbild) sind weniger
verwittert. Wenn man genau hinschaut, erkennt man im oberen Teil eine graue
Fläche, die sich von einem Stein auf den nächsten fortsetzt (gestrichelter
Kreis). Im rechten Teilbild der Abbildung 4.6 sind auf der Oberfläche von
Pflastersteinen unregelmäßige graue Flecken zu erkennen, die sich ebenfalls
über die Fuge erstrecken (gestrichelte Ellipse). Obwohl diese Fläche von
Menschen (Touristen) begangen wird, handelt es sich nicht um oberflächlich
aufgetragene Färbungen. Zur Erhöhung des Kontrastes hatte ich den
Fugenbereich vor der Aufnahme mit Wasser angefeuchtet. Rechts im Bild ist
der Übergang zur trockenen Oberfläche erkennbar. Auch in diesem Bild scheinen sich die
Flecken über die Fuge hinweg fortzusetzen.
3. Fugenübergreifende
Strukturen in Granit
Während es sich bei Kalkstein (theoretisch) um einen
Oberflächeneffekt handeln könnte, ist dies bei Granit nicht mehr möglich.
Die folgenden Oberflächenaufnahmen von Granitblöcken stammen aus dem
Taltempel des Chefren, der sich östlich der Chefren-Pyramide befindet und in
Abb. 4.7 schematisch dargestellt ist.
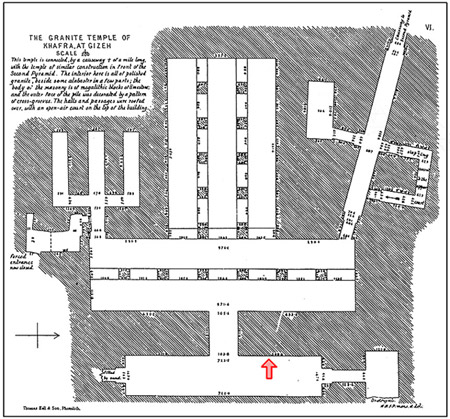 Abbildung 4.7:
Abbildung 4.7:
Grundriss vom Taltempel des Chefren. Der rote Pfeil deutet die Stelle an, wo
die Granitblöcke der Abbildungen 4.8 bis 4.11 aufgenommen wurden. Die
Zeichnung stammt von Sir William Flinders Petrie aus „The Pyramids and
Temples of Gizeh“aus dem Jahre 1883 (Tafel VI in [1]).
Auf der
Zeichnung befindet sich rechts unten der Eingang zum Tempel, so dass man
nach Durchschreiten des Durchgangs den Raum betritt, in dem sich wiederum
rechts die Blöcke der Abbildung 4.8 befinden (roter Pfeil). Tatsächlich
scheint sich auch hier dieses Phänomen zu zeigen. Weiße Pfeile kennzeichnen
den Verlauf der Fugen zwischen den Blöcken. Die rot gezeichneten Rahmen A, B
und C stellen Ausschnitte dar, die in den folgenden drei Fotos in
Nahaufnahme zu sehen sind.

Abbildung 4.8: Wandbereich mit
Fugen zwischen den Granitblöcken im Taltempel des Chefren. Für die
Ausschnitte A, B und C siehe die drei folgenden Abbildungen.
Der
dunklere Block links unten in Abb. 4.8 besteht eindeutig aus einer anderen
Steinsorte. Er ist durch breite Fugen, die anscheinend in der Neuzeit mit
Mörtel gefüllte wurden, mit den anderen Blöcken verbunden. Die übrigen Fugen
besitzen jedoch wieder diesen haarfeinen Verlauf, der selbst aus kurzer
Distanz teilweise kaum zu sehen ist. Es wird jetzt der Bereich genauer
untersucht, in dem sich die drei entsprechenden Granitblöcke treffen (rote
Rahmen).
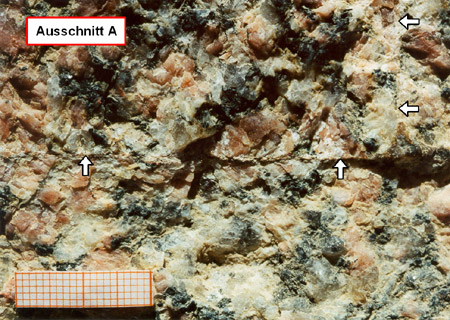
Abbildung 4.9: Ausschnitt A aus Abb. 4.8. Links
unten wurde ein zwei Zentimeter langes Stück Millimeterpapier befestigt, das
als Maßstab dient.
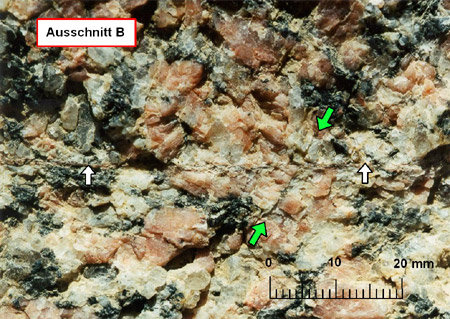
Abbildung 4.10: Ausschnitt B aus
Abbildung 4.8 mit waagerechter Fuge und Strukturen, die sich über die Fuge
fortzusetzen scheinen.

Abbildung 4.11: Ausschnitt C aus
Abbildung 4.8 mit senkrechter Fuge und ebenfalls fugenübergreifenden
Strukturen.
In Ausschnitt A (Abb. 4.9) stoßen rechts auf halber
Höhe drei Granitblöcke zusammen, wobei der Fugenverlauf wieder durch weiße
Pfeile gekennzeichnet wurde. Das Stück Millimeterpapier wurde als Maßstab
befestigt. Wir wenden uns jedoch nach links, wo in dieser und der nächsten
Abbildung 4.10 (Ausschnitt B) deutlich Strukturen erkennbar sind, die sich
über die Fuge fortzusetzen scheinen. In Ausschnitt B gibt es im mittleren
Bereich eine schräg ausgerichtete rötliche Struktur, und zwar sowohl
oberhalb als auch unterhalb der Fuge. Eine geneigt verlaufende Linie im
Granit (grüne Pfeile) setzt sich in der Verlängerung ohne seitlichen Versatz
fort.
Im Ausschnitt C (Abb. 4.11) verläuft die Fuge senkrecht. Auch hier
sind Granitstrukturen erkennbar, die sich über die Fuge fortsetzen. Gehen
wir von unten nach oben, so gibt es unten zunächst einen dunklen Bereich,
weiter in der Mitte einen etwas helleren grauen Bereich und weiter oben
einen rötlichen Bereich. Alle drei Färbungen gibt es sowohl links als auch
rechts der Fuge.
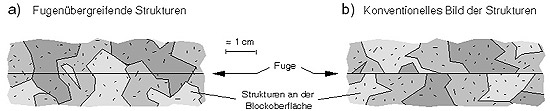
Abbildung 4.12: Stilisierte Darstellung
von Gesteinsstrukturen, z. B. bei Granit, im Bereich einer Fuge zwischen
zwei Blöcken. Im Teilbild a) sind die Strukturen fugenübergreifend, in b)
dagegen nicht.
Zum besseren Verständnis ist dieses Phänomen in Abb.
4.12 noch einmal schematisch dargestellt. Links sind die Strukturen
fugenübergreifend, rechts dagegen nicht. Heute werden Steinblöcke mit großen
Sägen z. B. mit speziellen Sägebändern durchgeschnitten, die einen
Sägespalt von einigen Millimetern Breite hinterlassen. Würden wir die zwei
Hälften eines solchen Blocks wieder zusammenschieben, so würde z. B. eine
schräg verlaufende Linie, wie in Abbildung 4.10, an der Fuge einen
seitlichen Versatz von einem oder mehreren Millimetern besitzen, weil durch
den Sägespalt etwas Material fehlt. Dies ist jedoch in dieser und den
anderen Abbildungen nicht erkennbar.
Es sieht so aus, als seien die
Blöcke quasi ohne Materialverlust durchgeschnitten und in ihrer
ursprünglichen Position wieder zusammengesetzt worden. Davon abgesehen, dass
die alten Ägypter dies nach bisherigem Wissen auf keinen Fall gekonnt haben,
sind selbst wir heute mit modernster Technik nicht in der Lage, dies zu
bewerkstelligen. Die Laser-Technik kommt nicht in Frage, denn ein
Laserstrahl schneidet durch Hitze. An den Granitblöcken sind jedoch
keinerlei Schmelzspuren erkennbar. „Elektronenstrahl-Schneiden“ wäre eine
weitere theoretische Möglichkeit, doch auch diese kommt nicht in Betracht,
da mit dieser Technik nicht metertief geschnitten werden kann. Würde man
Blöcke spalten und die Bruchhälften wieder zusammenfügen, so würden sich die
Strukturen über die Fuge hinweg fortsetzen. Doch auch diese Möglichkeit
fällt aus, da die Spaltflächen vermutlich nie völlig eben wären. Die
Seitenflächen der Steinblöcke in Giza sind jedoch sehr eben.
Die
Fotos der Abbildungen 4.9 bis 4.11 und 4.13 bis 4.15 wurden übrigens mit
einer Canon A1 mit Makro-Objektiv und einem eigens dafür hergestellten
Wandstativ aufgenommen. Die Abbildungen 4.13 bis 4.15 zeigen Fugen zwischen
Granitblöcken in stärkerer Vergrößerung an verschiedenen Stellen im
Taltempel des Chefren. Vor einiger Zeit zeigte ich einem Arbeitskollegen an
der Universität die Bilder und fragte ihn (bei Abb. 4.15), wie groß er die
Breite der Fuge einschätzt. Die spontane Antwort war: 100 µm. 100 Mikrometer
entsprechen einem zehntel Millimeter. Lieber Leser und liebe Leserin, Sie können sich anhand
des Maßstabes selbst ein Bild machen.
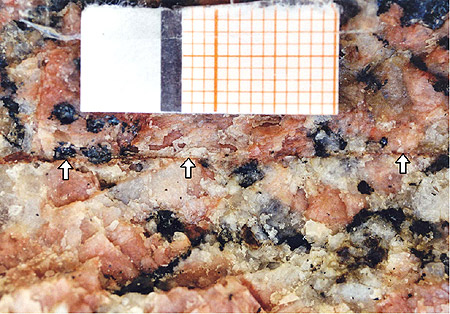
Abbildung 4.13:
Nahaufnahme einer Fuge zwischen Granitblöcken im Taltempel des Chefren mit
stärkerer Vergrößerung und Millimeterpapier als Maßstab. (Das
Millimeterpapier ist etwas unscharf, da die Schärfentiefe gering war und auf
den Granit fokussiert wurde.)
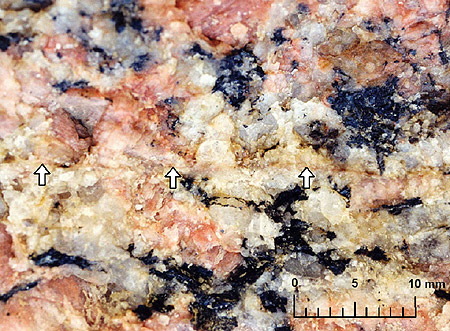
Abbildung 4.14: Weitere Fuge
zwischen Granitblöcken wie in Abb. 4.13.

Abbildung 4.15:
Eine kaum sichtbare Fuge zwischen Granitblöcken wie in Abb. 4.13.
4. Der mögliche Nachweis
Diese Genauigkeit ist fast unglaublich. Warum
wurde bei Granitblöcken mit mehreren Tonnen Gewicht und einer Genauigkeit
von einem zehntel bzw. ein paar zehntel Millimetern gearbeitet? Die Tatsache
als solche wäre theoretisch erklärbar, indem die Granitblöcke sehr lange und
präzise bearbeitet wurden. (Mit welchen Werkzeugen?) Das Phänomen der
fugenübergreifenden Strukturen – sollte es sich bewahrheiten – wäre
allerdings nicht mehr zu erklären, weil wir selbst heute mit modernster
Technik nicht gleichzeitig großflächig und derart verlustfrei schneiden
können. Die Erklärung, die Baumeister hätten mit Hammer und Meißel oder mit
Steinkugeln als Schlagwerkzeug gearbeitet, wäre damit völlig hinfällig. Ich
sage es ungern, aber sollte das Phänomen bestätigt werden, würde es
bedeuten, dass damals eine Hochtechnologie im Spiel war, die selbst heute
unbekannt ist.
Eine wissenschaftliche Überprüfung ist relativ leicht
möglich. Man braucht nur die Oberfläche im Bereich einer Fuge abzuschleifen
und zu polieren. Dann wären die Strukturen wie bei poliertem Marmor
eindeutig zu erkennen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Kernbohrung mit
Hohlbohrer. Man könnte einen zylinderförmigen Kern, der eine solche Fuge
enthält, bohren und herausbrechen, um ihn dann in einem Labor zu
analysieren. (Um in der Wand kein unschönes Loch zu hinterlassen, würde man
von der Außenseite des heraus gebohrten Kerns eine Scheibe abtrennen, um mit
dieser das Loch in der Wand wieder zu verschließen.) Nun wäre es möglich,
z. B. in einem Granitkorn aus dem Bohrkern die Kristallorientierung auf
beiden Seiten der Fuge zu vergleichen. Sollte nicht nur das Material sondern
auch die Kristallorientierung identisch sein, so wäre das der Beweis.
Es
gibt zum Verlauf der Fugen noch weitere Aspekte, doch diese würden hier den
Rahmen sprengen. Nähere Informationen sind im vorgestellten Buch zu finden.